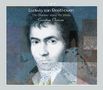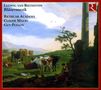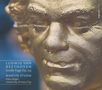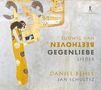Ludwig van Beethoven (1770–1827)
 Wenn es in der Musikgeschichte des Okzidents je eine Persönlichkeit gegeben hat, die ganz allein den Verlauf der Entwicklung revolutionierte, so war das Ludwig van Beethoven. Alles, was an Revolutionen nach ihm kam, ist ohne den Einfluss seines Schaffens nicht denkbar – angefangen beim jungen Franz Schubert, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem Giganten auseinandersetzte, über so überragende Gestalten wie Franz Liszt oder Richard Wagner, dessen neues Musiktheater ohne Beethoven ebensowenig denkbar gewesen wäre wie ein Johannes Brahms, der hinter sich stets den »Riesen« marschieren hörte. Und als endlich die geistigen Urenkel die »neue Musik« erfanden, die man so gern mit dem Beiwort »revolutionär« schmückt, kamen sie letztlich von Beethoven her, ob sie sich entweder bekannten oder von ihm abkehrten.
Wenn es in der Musikgeschichte des Okzidents je eine Persönlichkeit gegeben hat, die ganz allein den Verlauf der Entwicklung revolutionierte, so war das Ludwig van Beethoven. Alles, was an Revolutionen nach ihm kam, ist ohne den Einfluss seines Schaffens nicht denkbar – angefangen beim jungen Franz Schubert, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem Giganten auseinandersetzte, über so überragende Gestalten wie Franz Liszt oder Richard Wagner, dessen neues Musiktheater ohne Beethoven ebensowenig denkbar gewesen wäre wie ein Johannes Brahms, der hinter sich stets den »Riesen« marschieren hörte. Und als endlich die geistigen Urenkel die »neue Musik« erfanden, die man so gern mit dem Beiwort »revolutionär« schmückt, kamen sie letztlich von Beethoven her, ob sie sich entweder bekannten oder von ihm abkehrten.
Dabei hätte man das anfangs gar nicht erwarten sollen. Der Sohn eines Bonner Hofmusikers und Hobbytrinkers war am 16. Dezember 1770 zur Welt gekommen, sollte nach dem Willen seines Vaters als Wunderkind à la Mozart gehandelt werden und war doch alles andere als das: Erst durch die Unterweisung des Bonner Hoforganisten Christian Gottlieb Neefe lernte er systematischer, und als er seine erste Komposition gedruckt sieht, ist er zwölf Jahre alt – da hat das Salzburger Mirakel seine frühe Karriere schon hinter sich. Ihm begegnet der junge Beethoven 1787 in Wien, doch gleich muss er wegen einer schweren Krankheit der Mutter wieder heimkehren und die Geschicke der Familie in die Hand nehmen. In Diensten des Kurfürsten, vermag er zugleich mit neuen Kompositionen und vor allem seinem spektakulären Klavierspiel auf sich aufmerksam zu machen, so dass man ihn 1792 endlich wieder in die Donaumetropole ziehen lässt, wo jetzt die Zeit für Beethoven gekommen ist. Adlige Gönner vor allem sind es, die sich für ihn als erste erwärmen, obwohl er ein in jeder Hinsicht widerborstiger Anhänger der französischen Revolution ist. Doch seine Politik ist die Kunst, und mit der bezwingt er nach und nach auch die Öffentlichkeit. Als er 1800, nach den eher noch privaten Kreisen zugedachten Klaviersonaten, Trios und Streichquartetten seine erste Symphonie aufführt, ist trotz mancher Anklänge an Haydn und Mozart der neue Pulsschlag nicht mehr zu verkennen.
Und das wird so bleiben. Beethoven entfernt sich immer weiter von der Mode und wird doch eine internationale Berühmtheit – auch wenn er sich wegen seines immer schwächer werdenden Gehörs 1808 endgültig vom Pianistenpodium zurückziehen muss. Der drohenden Resignation setzt der Schöpfer immer »unerhörterer« Instrumentalwerke eine trotzige Entschlossenheit entgegen, die selbst die ärgsten Dürrephasen übersteht: Der Durchfall seiner einzigen Oper »Fidelio«, die erst nach mehreren Umarbeitungen triumphiert; die Sorge um seinen Neffen Karl, der ihm das Leben zur Hölle macht; die zunehmende äußere Vereinsamung – sie verhindern weder die alle Grenzen sprengende neunte Symphonie und die riesige »Missa solemnis« noch die »späten« Klaviersonaten und Streichquartette, die revolutionärer sind als alles, was in den nächsten hundert Jahren geschrieben wird.
Am 27. März 1827 stirbt Ludwig van Beethoven an den Folgen einer langen, schleichenden Krankheit. Die Welt der Musik ist nicht mehr, was sie vor ihm war. Tausende begleiten seine sterblichen Überreste zu ihrem Ruheplatz.